- Strafrecht
Touch-ID: Darf die Polizei beschlagnahmte Handys gegen den Willen von Beschuldigten entsperren, indem der Finger durch Zwang auf den Fingerabdrucksensor gelegt wird?
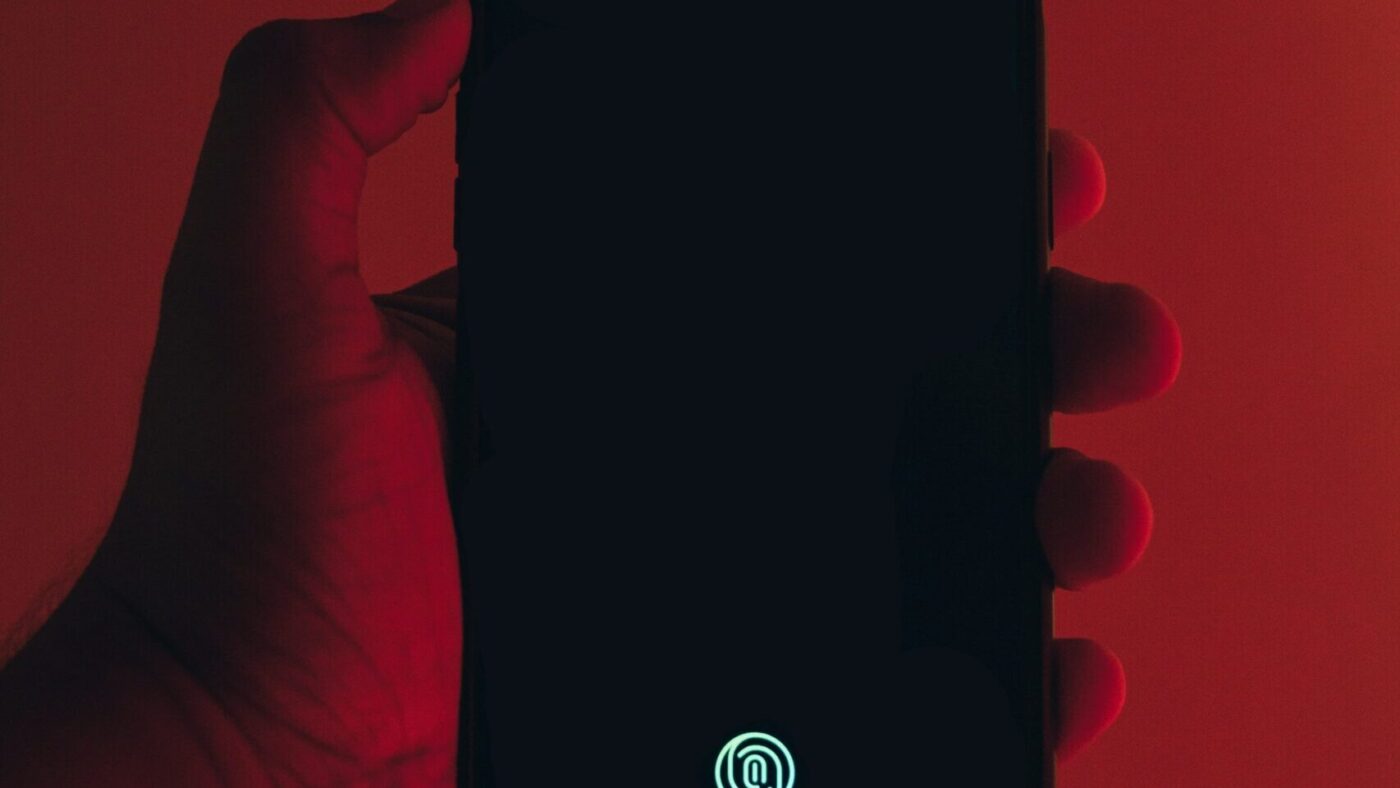
- Autor: Vivien Tzelepis
- Veröffentlicht: 21.08.2025
Das hatte der BGH in seinem aktuellen Beschluss vom 13.03.2025 zu beurteilen (Az. 2 StrR 232/24).
Fazit: Ermittlungsbehörden dürfen sich durch zwangsweises Auflegen von Fingern auf Fingerabdrucksensoren Zugang zu den Handyinhalten verschaffen. Zumindest unter der Voraussetzung, dass es sich um eine richterlich angeordnete Durchsuchung handelte, das Handy dabei aufgefunden wurde und der beabsichtigte Datenzugriff trotz seiner Eingriffsintensität auch verhältnismäßig ist.
Anlass der Entscheidung war die Wohnungsdurchsuchung eines Mannes, der u.a. als Kinderbetreuer beschäftigt gewesen ist und Beschuldigter in Bezug auf kinderpornographische Delikte war. Dem ehemaligen Erzieher wurde zunächst ein Berufsverbot ausgesprochen, da er bei seiner Arbeit in einer Kindertagesstätte Fotos unbekleideter Kinder anfertigte. Entgegen des ausgesprochenen Berufsverbots betätigte er sich später erneut als Babysitter, wobei er auch dabei kinderpornographisches Material anfertigte.
Eine Durchsuchung seines Wohnraums wurde richterlich angeordnet, wobei die zuständigen Beamten gleich mehrere Mobiltelefone auffanden, die der Beschuldigte nicht freiwillig entsperren wollte. Durch die sogenannte „Touch ID“-Funktion (Fingerabdrucksensor) konnten die Ermittlungsbeamten die Mobiltelefone dennoch entsperren, indem sie durch Anwendung unmittelbaren Zwangs den Finger des Beschuldigten an die entsprechende Sensorstelle der Mobiltelefone legten.
In dem darauffolgenden Gerichtsprozess wurde – aus Verteidigersicht absolut nachvollziehbar – der Rechtmäßigkeit dieser Maßnahme und damit auch der Verwertung der dadurch gewonnen Beweise durch die Verteidigung des Beschuldigten widersprochen.
Der 2. Strafsenat des Bundesgerichtshofs entschied jedoch, dass die Maßnahme der Beweismittelgewinnung rechtmäßig war. Da die Wohnungsdurchsuchung gerade dem Auffinden der mobilen Endgeräte des Beschuldigten diente, der Beschuldigte die Entsperrung verweigerte und ein Zugriff anders nicht möglich gewesen wäre, sei das erzwungene Fingerauflegen geeignet und erforderlich gewesen. Als Rechtsgrundlage zog der Bundesgerichtshof § 81b Abs. 1 i.V.m. §§ 94 ff. StPO heran.
Leitender Gedanke dieser Entscheidung war die Aufklärung der Straftaten und damit auch die Vermeidung von potenziell weiter zu begehenden Straftaten durch den Beschuldigten. Soweit dies auch grundsätzlich nachvollziehbar ist: Als Beschuldigter muss man sich nicht selbst belasten. Und auch die Mitwirkung zum Entsperren des Handys darf von Beschuldigten rechtmäßig verweigert werden.
Wenn der BGH nun das zwangsweise Entsperren sichergestellter Handys durch Polizeibeamte für rechtmäßig erklärt, entsteht dadurch aus Verteidigersicht zwangsläufig ein Spannungsverhältnis zu prozessualen Rechten von Beschuldigten.
Vivien Tzelepis, LL.M., Rechtsanwältin u. Fachanwältin für Strafrecht und Minari Cathrine Holloway, Studentin der Rechtswissenschaften
Foto: © Yogesh Rahamatkar (https://unsplash.com)
Weitere
Beiträge

- 14.08.2025
- Strafrecht
Wann klauen erlaubt ist. Der straflose Krypto-Diebstahl?
Das Oberlandesgericht Braunschweig hat hierzu in seinem Beschluss vom 18.09.2024 (Az. 1 Ws 185/24) eine durchaus interessante Entscheidung g …

- 11.08.2025
- Strafrecht
Skurriles über Leichen „gehen“: Ist es ein strafbares unerlaubtes Entfernen vom …
Mit dieser nicht allzu täglichen Rechtsfrage hatte sich aktuell das Amtsgericht Hagen zu beschäftigen (AG Hagen, Beschl. v. 06.06.2025, Az. …

- 4.08.2025
- Strafrecht
Sicherheit im Gegenzug für Freiheit – Mehr Befugnisse für den NRW-Verfassu …
Der Balanceakt zwischen gesellschaftlicher Sicherheit und der Freiheit des Einzelnen war schon immer anspruchsvoll und die vielfältigen Bedr …
